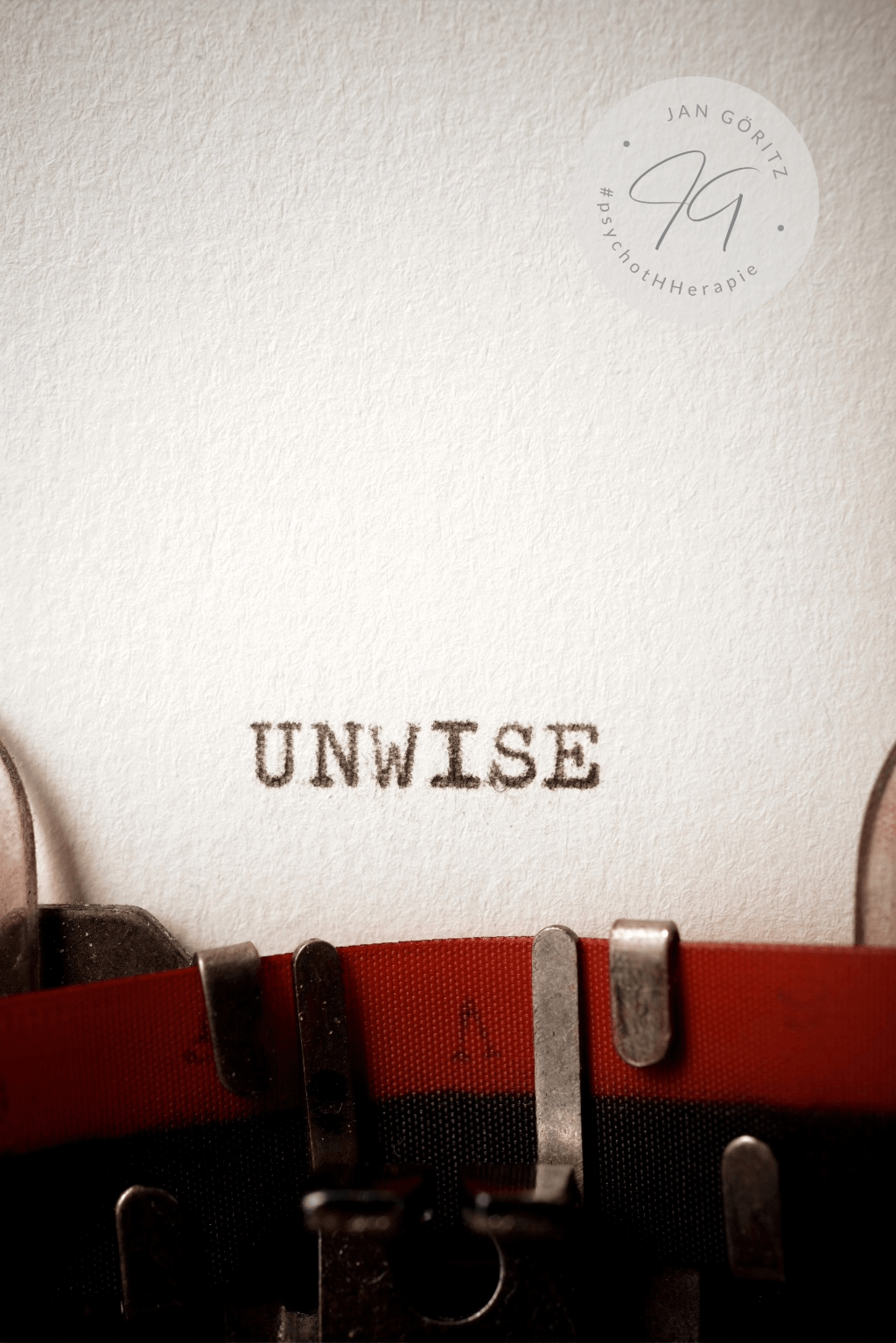Brexit
Ich starte diesen Artikel mit einem der prominentesten Beispiele der jüngeren Vergangenheit zum Thema „zu Ende denken“: dem Brexit.
Ursprünglich wurde den Briten von der Bewegung um Boris Johnson versprochen, dass sich ihr Leben nach einem Brexit deutlich verbessern würde. Premier David Cameron hoffte, auf ein Ergebnis für den Verbleib in der EU, doch die Brexit-Befürworter um Boris Johnson versprachen den Briten für den Fall des EU-Austritts:
- stärkere Autonomie
- weniger Verwaltung
- weniger Zuwanderung
- ein besseres Gesundheitssystem
- geringere Steuern
- bessere bilaterale Handelsabkommen
Denn, so wurde erzählt, dass es nicht so gut ist, wie es sein könnte, liegt an der EU. Und wenn es einen so klar definierten Schuldigen gibt, wie hier die EU, dann gibt es auch immer eine einfache Lösung. In diesem Fall hieß sie „Brexit“. Und schon würden Milch und Honig fließen.
Man muss wie ein denkender Mensch handeln und wie ein handelnder Mensch denken. (Henri Bergson)
Natürlich gab es auch kritische Stimmen, wie die des damaligen britischen Finanzministers George Osborne, der vor vielen der heutigen Brexit-Folgen gewarnt und für einen Verbleib in der EU gekämpft hat.
Folgen des Brexit:
- signifikant höhere Kosten für Verwaltung, Logistik und Zöllen
- gesunkene Umsatzerlöse
- Probleme im Gesundheitswesen
- Probleme im Transportgewerbe
- Probleme in der Landwirtschaft
- ärmere Haushalte
- Stagnation bei Investitionen
- Einbruch im Warenverkehr mit der EU um 10-15%
Das ist nur ein Ausschnitt. Insgesamt war der Brexit für alle Beteiligten, auch für Großbritannien, ein Schuss ins Knie. Ich wage die Behauptung, dass das bei populistischen Lösungswegen immer so sein wird. Die Themen und Zusammenhänge sind niemals so einfach, wie sie von Populisten dargestellt werden. Und für komplexe Zusammenhänge gibt es selten, wahrscheinlich nie, einfache Lösungen.
In Bezug auf den Brexit habe ich mal diesen Satz gehört: „Das ist, als würde man sein Haus anzünden, nur, weil man ein bisschen friert.“
Was ich aus diesem Satz auch rauslese, ist, dass man auf dumme Ideen kommt oder diesen glaubt, weil man zu bequem ist, wirkliche Lösungen für Probleme, die es ja tatsächlich gibt, zu suchen, und es vielleicht auch nicht ertragen kann, dass man bei solchen wirklichen Lösungen mitunter auch Abstriche bei der eigenen Agenda machen muss.
Möglicherweise fragen Sie sich gerade, was denn der Brexit nun mit Ihnen persönlich zu tun hat. Das verrate ich Ihnen im nächsten Abschnitt.
Quelle: https://www.lpb-bw.de/brexit
Zuende denken im Privaten
Vielleicht mehr, als Sie zunächst denken. Denn genau dieses Muster, ein komplexes Problem mit einer scheinbar einfachen Lösung wegdrücken, begegnet mir regelmäßig auch in meiner Praxis. Natürlich geht es dabei nicht um Handelsabkommen oder Zölle, sondern um ganz persönliche Lebensentscheidungen.
Wir haben im Leben darum zu ringen, so denkend und so empfindend zu bleiben, wie wir es in der Jugend waren. (Albert Schweitzer)
Wenn Ihr Job Sie nicht zufrieden macht, klingt eine Kündigung im ersten Moment wie der Befreiungsschlag. Wenn Ihre Beziehung hakt, scheint eine Trennung oft der einfachste Ausweg. Und wenn Sie sich in Ihrem Körper unwohl fühlen, wirkt eine Crash-Diät wie die schnelle Antwort. Doch so wie beim Brexit die erhofften Milch-und-Honig-Tage ausblieben, bleibt auch im privaten Alltag oft die Ernüchterung nicht aus.
Der Grund dafür ist, dass radikale Lösungen, denn das sind schnelle Lösungen meistens, nicht in der Lage sind, wirkliche und nachhaltige Verbesserungen zu schaffen. Meistens haben die Themen und Probleme deutlich mehr Dimensionen, als das man sie mit einer eindimensionalen Betrachtungsweise wirklich durchdringen könnte. Probleme lassen sich also selten mit einem simplen „Raus hier!“ lösen. Und was kurzfristig Erleichterung verschaffen oder das Gefühl von Macht suggerieren kann, wird nach hinten raus oftmals teuer bezahlt. Sei es finanzielle Unsicherheit nach einer Kündigung, Einsamkeit nach einer vorschnellen Trennung oder gesundheitliche Rückschläge nach einer ungesunden Diät.
Praxisbeispiel
Immer wieder sind natürlich auch Klientinnen und Klienten mit Beziehungsthemen bei mir. Manchmal kommen Sie nach einer Trennung, so wie eine ehemalige Klientin, Ende zwanzig.
Sie saß mir gegenüber, wie man sich das frisch getrennt vorstellt: weinend, sauer, sich selbst infrage stellend und wieder weinend. Sie vereinbarte Termine und der erste Termin drehte sich um ihre Biografie und die bisherige Beziehungshistorie. Sie berichtete davon, dass es für sie nicht ungewöhnlich sei, eher kurze Beziehungen zu haben, die alle „wirklich total toll“ angefangen haben und siebereits mehr als einmal davon ausgegangen ist, die große Liebe gefunden zu haben.
Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln. (Anatole France)
Wir haben uns also auf den Weg gemacht, Glaubenssätze identifiziert und Muster, Erwartungen und Ängste herausgearbeitet. Zur dritten Sitzung erschien eine vollkommen veränderte Frau: Sie strahlte über das ganze Gesicht und berichtete, dass sie jetzt wirklich den Richtigen gefunden habe und es ihr gut gehe. Sie erzählte mir davon, wie er sie in einer Bar angesprochen habe und sie „sofort verliebt gewesen“ sei. Seit diesem Zeitpunkt haben die beiden so gut wie jede Minute miteinander verbracht. Er hatte noch Urlaub und sie hat sich krankschreiben lassen.
Natürlich bin ich hellhörig geworden und habe ob der emotional dramatischen Wendung auf die zuvor erwähnten Glaubenssätze, wie beispielsweise „wenn man sich wirklich liebt, streitet man sich nicht“ und das Muster hingewiesen, immer einen Partner zu haben und sich kaum Zeit für sich selbst zu gönnen. Das änderte aber nichts an dem Entschluss der Klientin, die Therapie abzubrechen, da es ihr ja „wieder gut“ gehe. Es war fast wie der Brexit auf privater Ebene: Sie beendete eine Beziehung in der Hoffnung, dass dann alles besser würde. Aber ohne eine tiefere Auseinandersetzung mit den eigenen Handlungsimpulsen, Galubenssätzen und Mustern ist eine wirkliche Verbesserung auf diesem Sektor kaum möglich.
Der gemeinsame Nenner
Ob Brexit oder Beziehungsende – das Muster ist ähnlich:
-
Kurzfristig will man ein unangenehmes Gefühl loswerden.
-
Langfristig übersieht man, dass dieses Gefühl – wenn überhaupt – sich nur kurzzeitig bemerkbar macht, bevor die Situation sich wieder verschlechtert und häufig schlechter ist, als vorher.
Stellen Sie sich vor, bei Ihnen fällt im Winter die Fernwärme aus. Am nächsten Tag kommt ein Nachbar vorbei und sagt: „Mann, das ist ja kalt bei Euch!“
Natürlich fragen Sie verwundert nach: „Wie?! Bei Euch nicht?“
Woraufhin er Ihnen stolz erzählt, dass er eine ganz tolle Lösung gefunden hat: „Ich habe unser Haus angezündet.“Wahrscheinlich würden Sie schnell erkennen, dass das nicht die Lösung ist, nach der Sie suchen.
Typische Alltagsszenarien
Vielleicht kennen Sie das auch:
-
Der Job
Der Chef nervt, das Team läuft nicht rund, und die Aufgaben fühlen sich sinnlos an. Die schnelle Lösung ist natürlich die Kündigung. Die späte Erkenntnis ist manchmal die, dass ein neuer Job nicht automatisch die eigenen Muster löst und wir Konflikte, Selbstzweifel oder Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, mitnehmen.
-
Die Diät
Fünf Kilo in zwei Wochen – das klingt fantastisch. Aber wenn der Körper nach der Radikaldiät im Energiesparmodus läuft, kommt das Gewicht meistens schnell wieder zurück. Das Problem war nie nur das Gewicht, sondern auch der Umgang mit Stress, Emotionen und die Frage nach der Selbstfürsorge.
-
Der Kontaktabbruch
„Die Freundin hat mich enttäuscht, jetzt ist Schluss.“ Das klingt im ersten Augenblick ausgesprochen konsequent. Aber Konflikte nicht auszuhalten und Beziehungen sofort zu beenden, kann langfristig in Isolation führen. Denn Nähe entsteht nicht durch Harmonie, sondern durch die Fähigkeit, Krisen gemeinsam durchzustehen.
Auch im Denken gibt es eine Zeit des Pflügens und eine Zeit der Ernte. (Ludwig Wittgenstein)
Warum wir nicht zuende denken
Die Psychologie kennt dafür mehrere Erklärungen:
-
Kurzfristige Belohnung: Unser Gehirn liebt schnelle Erleichterung. Dopamin fließt, das gute Gefühl kommt sofort.
-
Vermeidung von Schmerz: Lieber eine harte, klare Entscheidung als das Aushalten von Unsicherheit und Unklarheit.
-
Kognitive Verzerrungen: Wir unterschätzen oft die Komplexität von Situationen („Wenn ich X tue, wird Y automatisch besser“).
Der nächste Kick oder zu Ende denken
Wenn wir Entscheidungen nur nach dem Prinzip der kurzfristigen Erleichterung treffen, also etwas nicht zu Ende denken, dann laufen wir Gefahr, in eine Art Befriedigungssucht hineinzuschlittern. Gemeint ist damit nicht unbedingt eine klassische Abhängigkeit wie bei Alkohol oder Drogen, sondern ein psychologisches Muster: Wir jagen von Kick zu Kick, immer auf der Suche nach dem nächsten schnellen Hoch.
Das funktioniert eine Zeit lang erstaunlich gut. Die Euphorie einer neuen Beziehung, die Leichtigkeit nach einer Kündigung, der Stolz auf die ersten verlorenen Kilos – all das gibt uns einen starken, aber eben auch flüchtigen Dopaminschub. Und sobald dieser abflaut, stehen wir schlechter da, als zuvor. Denn der Absturz nach einem Hoch lässt uns immer tiefer fallen, als wir vorher waren.
Und wie jede Sucht hat auch dieses Muster einen Preis:
-
Die Kicks müssen immer schneller kommen, sonst hält man das Loch dazwischen nicht aus.
-
Die Fähigkeit, schwierige Gefühle durchzustehen, verkümmert.
-
Langfristige, tiefergehende Erfüllung wird immer unwahrscheinlicher, weil wir die eigentlichen Ursachen nicht bearbeiten.
Das ist der Punkt, an dem viele Menschen merken, dass sie im Kreis laufen. Erst wenn wir innehalten und zu Ende denken – mit allen Konsequenzen, können wir langfristig gute Entscheidungen treffen. Ansonsten ähneln wir eher einem Junkie auf der Suche nach dem nächsten Schuss.
Und lassen Sie mich das auch kurz klarstellen: eine gute Entscheidung ist so gut wie nie eine 100%-Entscheidung. Es gibt bei guten Entscheidungen auch immer einen schmerzhaften Anteil, der aber meist nur kurz wirkt.
Wie Sie Dinge zu Ende denken lernen können
-
Fragen Sie sich: Was kommt nach dem ersten Schritt?
Nicht: „Wie geht es mir morgen nach der Entscheidung?“ Sondern: „Wie sieht mein Leben in drei Monaten, in einem Jahr, in fünf Jahren aus?“
-
Spielen Sie Szenarien durch
Wenn Sie kündigen: was machen Sie in der Übergangszeit?
Wenn Sie sich trennen: wie organisieren Sie Ihr soziales Netz neu?
Wenn Sie eine Diät beginnen: was ist Ihr Plan für den Alltag danach?
-
Holen Sie sich Feedback
Manchmal sind wir selbst zu sehr im Tunnel. Ein Gespräch mit Freunden, Kollegen oder einem Therapeuten kann blinde Flecken sichtbar machen.
-
Aushalten lernen
Oft ist die eigentliche Veränderung dort, wo es unangenehm wird. Therapieabbrüche zum Beispiel passieren häufig genau dann, wenn man kurz vor einem Durchbruch steht. Aushalten heißt nicht, alles ertragen zu müssen, sondern eben nicht sofort die Flucht zu ergreifen.
Ein Gedanke zum Schluss
Dinge zu Ende denken heißt nicht, ewig zu grübeln oder alles perfekt zu planen. Es heißt, sich bewusst zu machen, dass Entscheidungen Konsequenzen haben – kurzfristig und langfristig.
Weiterführende Informationen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
FAQ
Viele Menschen vermeiden es, Dinge zu Ende zu denken, weil sie unangenehme Gefühle wie Unsicherheit, Angst oder Zweifel nicht aushalten möchten. Stattdessen greifen sie zu schnellen Lösungen, die kurzfristig Erleichterung bringen, langfristig aber selten wirklich helfen.
Schnelle Lösungen wirken verlockend, weil sie sofortige Befriedigung versprechen. Doch sie blenden oft wichtige Konsequenzen aus. Das kann dazu führen, dass Probleme nicht gelöst, sondern nur verschoben oder sogar verstärkt werden.
Wenn Sie immer wieder dieselben Entscheidungen treffen und sich dabei kurzzeitig gut fühlen, aber nach kurzer Zeit erneut unzufrieden sind, ist das ein Hinweis auf eine Kick-Spirale. Typische Beispiele sind wiederkehrende Beziehungsabbrüche, ständiger Jobwechsel oder ungesunde Diäten.
Hilfreich ist es, bewusst innezuhalten und sich zu fragen: „Wie sieht die Situation in drei Monaten oder in einem Jahr aus?“ Auch Gespräche mit Freunden oder in einer psychologischen Beratung können helfen, blinde Flecken aufzudecken und langfristig tragfähige Lösungen zu entwickeln.