Bewiesen – Multitasking kann gefährlich sein
Veröffentlicht am: 07.07.2025 von Jan Göritz
Veröffentlicht am: 07.07.2025 von Jan Göritz
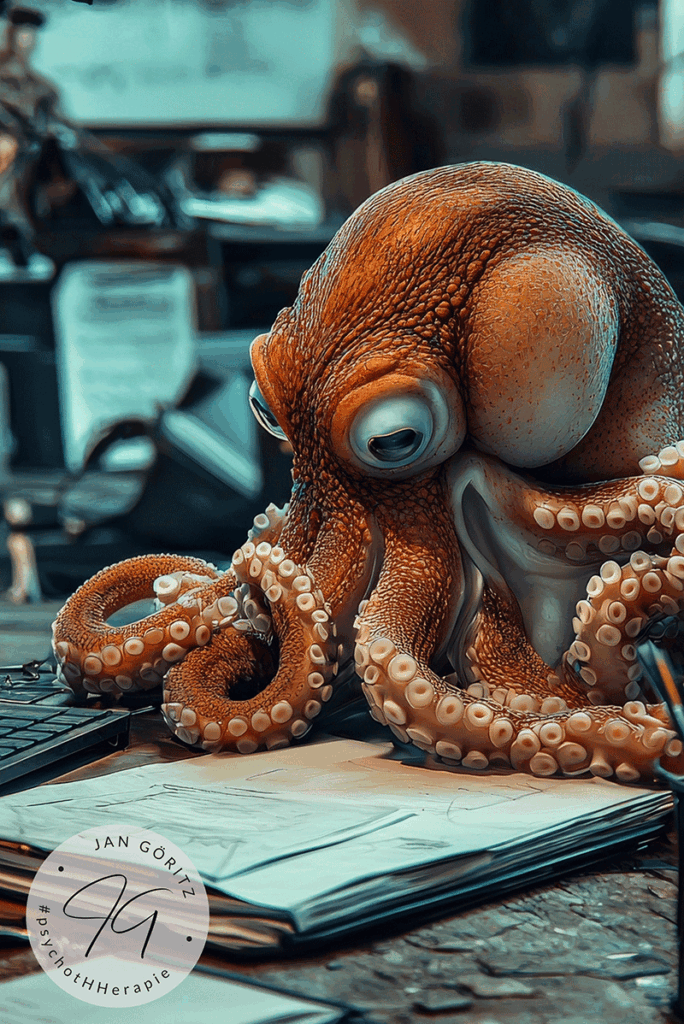
Foto: © Adobe Stock
Das sogenannte Modell der multiplen Ressourcen des Psychologen Christopher Wickens hilft zu verstehen, warum Multitasking uns so oft an unsere Grenzen bringt. Es besagt, dass unser Gehirn zwar grundsätzlich mehrere Aufgaben parallel verarbeiten kann – aber nur dann, wenn diese Aufgaben unterschiedliche mentale Ressourcen beanspruchen. Hören und gleichzeitig laufen? Kein Problem. Autofahren und ein Hörbuch hören? Meist möglich. Aber: Sobald zwei Tätigkeiten dieselben Ressourcen fordern – etwa beide sprachlich oder beide logisch-kognitiv sind – kommt es zu Überlastung.
In diesem Artikel geht es genau um solche Situationen: Wenn wir versuchen, gleichzeitig zu denken, zu planen, zu schreiben, zu kommunizieren – also alles, was denselben Teil unseres mentalen Systems beansprucht. Und genau das ist der Punkt, an dem Multitasking nicht nur ineffektiv wird, sondern uns auf Dauer schadet.
Ich hatte ein Gespräch über Multitasking, bei dem mir wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, wie hartnäckig sich dieser Mythos hält, dass Multitasking bei Menschen überhaupt funktioniert.
Morgens beim ersten Kaffee bereits E-Mails checken. Im Kopf die Punkte durchgehen, die am Tag erledigt werden müssen, während man im Meeting sitzt. Für viele Menschen gehört das zum Alltag.
Wenn ich in der Praxis versuche, gleichzeitig etwas aufzuschreiben und mit dem Klienten oder der Klientin zu sprechen, schreibe ich entweder das, was ich sage oder sage das, was ich schreibe? Multitasking? Fehlanzeige.
Bin ich ein Einzelfall? Nein. Jedesmal, wenn ich sage: „Moment bitte, ich kann nicht gleichzeitig schreiben und sprechen, da kommt mindestens auf einer Seite Quark raus.“, bringt mir der Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt, Verständnis entgegen: „Das kenne ich.“ oder „Das geht mir auch so.“
Aber wie häufig machen Vergleichbares?
Wie genau hört man dem anderen zu, wenn man parallel eine Mail formuliert? Wie sehr ist man bei den Kindern, wenn man gleichzeitig eine Nachricht tippt?
Die letzten beiden Beispiele haben nichts mit dem Kontakt zu anderen Menschen zu tun. Auch da wird etwas auf der Strecke bleiben, aber es stört den Podcast nicht, wenn Sie nur mit einem Ohr zuhören und auch das Video wird sich nicht darüber beschweren, dass Sie nicht mit Ihrer vollen Aufmerksamkeit dabei sind. Und da sind wir wieder beim Multitasking: Ein Rechner kann gleichzeitig den neusten Blockbuster und das neue Album Ihrer Lieblingsband abspielen. Klingt dann sicherlich anstrengend, aber beides bekommt die gleiche „Aufmerksamkeit“. Und zwar parallel zueinander.
Konzentriere alle deine Gedanken auf die Arbeit, die du gerade machst. Die Sonnenstrahlen brennen erst, wenn sie gebündelt sind. (Alexander Graham Bell)
Und unser Gehirn ist eben kein Hochleistungsprozessor mit unbegrenzten parallelen Kapazitäten. Es wechselt nur extrem schnell zwischen Aufgaben – was sich wie Gleichzeitigkeit anfühlt, ist in Wahrheit ein ständiger Wechsel. Das hat zur Folge, dass wir unsere Aufmerksamkeit aufteilen. Bei den oben erwähnten Beispielen „Telefonat“ und „Gespräch mit den Kindern“ vermute ich, dass der Hauptfokus beim formulieren der Nachrichten liegt und nur nebenbei zugehört wird.
Aufgabe A – Einzeltätigkeit (Monotasking):
Zeit stoppen und notieren.
Aufgabe B – Multitasking (abwechselnd):
Zeit stoppen und notieren.
Fast alle Menschen brauchen für Aufgabe B deutlich länger – und machen häufiger Fehler.
Warum? Weil unser Gehirn nicht zwei parallele Denkprozesse führen kann, sondern zwischen zwei Aufgaben hin- und herspringen muss. Genau dieser Wechsel kostet Zeit, Energie und Konzentration.
Es gibt Menschen, die denken, sie wären multitasking-fähig – doch neurowissenschaftlich betrachtet ist das ein Irrtum. Unser Gehirn ist schlicht nicht dafür gebaut, mehrere komplexe Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Der Neurowissenschaftler Earl Miller vom MIT bringt es auf den Punkt: „Das Gehirn ist nicht fürs Multitasking gemacht. Was wir für Multitasking halten, ist in Wahrheit ein ständiger Wechsel zwischen Aufgaben – und dieser Wechsel kostet jedes Mal kognitive Ressourcen.“
Ein Mann, der zwei Kaninchen jagt, fängt keins. (Römisches Sprichwort)
Dieses sogenannte Task-Switching führt nicht nur zu Fehlern und Konzentrationsverlust, sondern verändert auch unsere Gewohnheiten. Denn kleine Tätigkeiten – wie das schnelle Versenden einer Nachricht oder das Überfliegen einer E-Mail – setzen jedes Mal einen kleinen Dopaminschub frei. Und genau das macht süchtig. Um dieser Sucht nachzukommen, begeben wir uns in einen Strudel: Wir machen viele Sachen, aber nichts davon wirklich gut, manchmal nicht einmal bis zuende.
Die Folgen sind messbar: Eine Studie der University of London zeigte, dass Menschen, die beim Denken multitasken, einen zeitweisen IQ-Abfall erleiden – vergleichbar mit einer durchwachten Nacht oder dem Konsum von Cannabis. Gleichzeitig steigt der Cortisolspiegel, unser zentrales Stresshormon. Wer häufig zwischen Aufgaben wechselt, fühlt sich schnell erschöpft, obwohl der Tag gerade erst begonnen hat.
Und Multitasking beeinflusst uns nicht nur im jeweiligen Moment negativ: Erste Studien deuten darauf hin, dass Multitasking sogar langfristige Veränderungen im Gehirn hervorrufen könnte. So zeigte eine Untersuchung der University of Sussex, dass Menschen mit ausgeprägtem Medien-Multitasking eine geringere Dichte im cingulären Cortex aufweisen – einem Hirnareal, das unter anderem für Empathie und emotionale Regulation zuständig ist. Ob Multitasking die Ursache oder das Ergebnis dieser Veränderungen ist, ist noch unklar. Eins ist aber sicher: Multitasking tut uns nicht gut.
Wenn Multitasking so schädlich ist – warum tun wir es dann trotzdem immer wieder? Die zweite der NLP-Grundannahmen besagt, dass jedes Verhalten – auch wenn es problematisch zu sein scheint – eine für uns positive Absicht verfolgt. Die Antwort liegt also auch in der Funktionsweise unseres Belohnungssystems. Jedes Mal, wenn wir eine kleine Aufgabe abhaken – eine Mail beantworten oder einen Rückruf tätigen – schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Diese Dosis Glücksgefühl vermittelt uns das gute Gefühl, produktiv zu sein. Doch in Wahrheit erledigen wir oft nur oberflächliche Dinge, während die wirklich wichtigen Aufgaben liegen bleiben.
Dazu kommt: Unsere digitale Welt buhlt förmlich um unsere Aufmerksamkeit. Nach jedem Reel folgt ein nächstes, wir können scrollen ohne Ende und es kommen immer neue Postings. Dazu gibt es dann Benachrichtigungen für alles Mögliche: Nachrichten aus aller Welt werden uns per Push-Benachrichtigung aufs Display gespült, dann SMS, WhatsApp, Instagram und was auch immer. Dazu ist unser Handy selten weiter als eine Armlänge von uns entfernt. Das erschwert es, konzentriert bei einer Sache zu bleiben. Multitasking fühlt sich deshalb nicht nur normal an, sondern sogar notwendig. Viele Menschen erleben eine körperliche Unruhe, wenn sie sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren sollen – ein Phänomen, das eher an Entzug erinnert als an freie Entscheidung.
Das Erkennen dieser Mechanismen ist wie so häufig der erste Schritt zur Veränderung. Denn sobald wir merken, dass unser scheinbares Produktiv-Sein oft nur eine Reaktion auf innere Unruhe oder äußere Reizüberflutung ist, können wir beginnen, neue Gewohnheiten zu entwickeln – bewusster, langsamer und am Ende sogar effizienter.
Multitasking erhöht den Stresspegel, ohne dass dabei mehr Produktivität herauskommt. Die Folgen:
Langfristig kann das zu Erschöpfungsdepressionen, Angststörungen oder sogar einem handfesten Burnout führen. Und das nur, weil wir versuchen, gegen unsere biologische Ausstattung zu arbeiten.
Hand aufs Herz:
Multitasking hat sich heimlich in unseren Alltag geschlichen – vor allem durch digitale Medien und unser Gehirn ist evolutionär nicht darauf vorbereitet, mit ständiger Reizüberflutung umzugehen.
Digitales Multitasking bedeutet eine permanente Ausschüttung von Dopamin.
Jede neue Nachricht, jeder Like, jedes Update wirkt wie ein kleiner Dopamin-Kick – doch der Preis ist hoch: Konzentrationsfähigkeit, emotionale Tiefe und echtes, tiefes Verarbeiten bleiben auf der Strecke.
Für Eltern – und ganz besonders für Alleinerziehende – ist Multitasking oft eine Notwendigkeit. Während das eine Kind Hausaufgaben macht, das andere schreit, der Topf auf dem Herd überkocht und gleichzeitig die Kita eine Mail wegen des nächsten Ausflugs schickt, bleibt meistens keine Wahl: Alles muss irgendwie gleichzeitig laufen. Doch genau hier entsteht ein fataler Teufelskreis. Denn je mehr Aufgaben parallel erledigt werden müssen, desto höher der Stress, desto geringer die Konzentration – und desto größer die Gefahr, am eigenen Anspruch zu scheitern.
Alleinerziehende trifft es doppelt hart: Es gibt niemanden zum Abgeben, kein Gegenüber, das mal eben übernimmt oder entlastet. Viele meiner Klientinnen und Klienten in dieser Situation berichten von einem inneren Dauer-Druck, nie genug zu tun – und gleichzeitig nie richtig „da“ zu sein. Weder bei der Arbeit noch bei den Kindern – und schon gar nicht bei sich selbst.
Multitasking fühlt sich für viele Eltern an, als gäbe es kein Entkommen – aber es lohnt sich, kleine Inseln des „Monotaskings“ zu schaffen. Fünf Minuten bewusst beim Zähneputzen des Kindes nur beim Kind zu sein. Vielleicht fokussieren Sie jeden Zahn einzeln und putzen ihn mit einer gewissen Wertschätzung. Oder eine Mahlzeit ohne Handy, essen mit Achtsamkeit: kauen Sie bewusst und riechen und schmecken Sie genau hin.
Und vor allem: Hinterfragen Sie den eigenen Anspruch immer wieder, gerne liebevoll und ohne Druck. Denn nicht Perfektion ist das Ziel, sondern Verbindung.
Üben Sie, eine Sache zur Zeit zu machen. Was banal klingt ist aber schnell eine Herausforderung in unserer Welt. Fangen Sie klein an: z. B. beim Essen einfach nur essen. Erinnern Sie sich gerne immer wieder an den glücklichen buddhistischen Mönch.
Wie häufig reagieren Sie auf Signale Ihres Handys? Beginnen Sie, wieder selber zu bestimmen, wann Sie das Gerät zur Hand nehmen:
Ich versichere Ihnen, Sie werden nichts verpassen!
Kurze, bewusste Pausen helfen dem Gehirn beim Reset. Gehen Sie eine halbe Stunde am Tag spazieren,- ohne Musik oder Podcast. Nur gehen und atmen.
Letztlich sind wir ja auch nur Tiere,- warum soll die Konditionierung bei uns schlechter funktionieren, als bei den Pawlow’schen Hunden?
Also suchen Sie sich Musik raus, bei der Sie sich gut fokussieren können und schaffen Sie eine Verknüpfung zwischen Reiz (Musik) und Reaktion (Fokussierung). Wenn Sie die gleiche Platte häufig genug in Kombination mit fokussiertem Arbeiten gehört haben, werden Sie sich irgendwann bei den ersten Takten automatisch fokussieren.
Achtsamkeit oder Mindfulness ist keine esoterische Modeerscheinung, sondern ein praxistaugliches Werkzeug gegen die Multitasking-Falle. Apps wie Headspace oder auch entsprechende Videos auf Youtube können beim Einstieg helfen.
Multitasking ist kein Zeichen von Produktivität, sondern ein Stressverstärker. Es erschöpft unser Gehirn, mindert unsere Leistungsfähigkeit und raubt uns die Fähigkeit, präsent zu sein – in der Arbeit, im Alltag und mit uns selbst.
Was wir brauchen, ist nicht mehr Tempo, sondern mehr Bewusstheit. Nicht mehr Kontrolle, sondern mehr Klarheit.

Foto: © InputUX / Adobe Stock
Starte mit kleinen Schritten:
• Handy in einen anderen Raum legen.
• Zeiten für E-Mails festlegen.
• Bei einer Aufgabe bleiben – auch wenn es innerlich zieht, kurz „nur mal schnell“ etwas anderes zu tun.
Jede bewusste Entscheidung für Monotasking stärkt deine mentale Klarheit.