Das Toleranzparadoxon
Veröffentlicht am: 29.09.2025 von Jan Göritz
Veröffentlicht am: 29.09.2025 von Jan Göritz
Das Toleranzparadoxon nach Karl Popper ist eine tiefgründige Einladung, die Balance zwischen Offenheit und Schutz in unserem persönlichen und gesellschaftlichen Leben zu finden. Dieses Paradoxon, das Popper bereits 1945 formulierte, zeigt auf: Wer alles toleriert, riskiert, dass Intoleranz das Feld übernimmt und somit die ursprüngliche Toleranz zunichte macht.
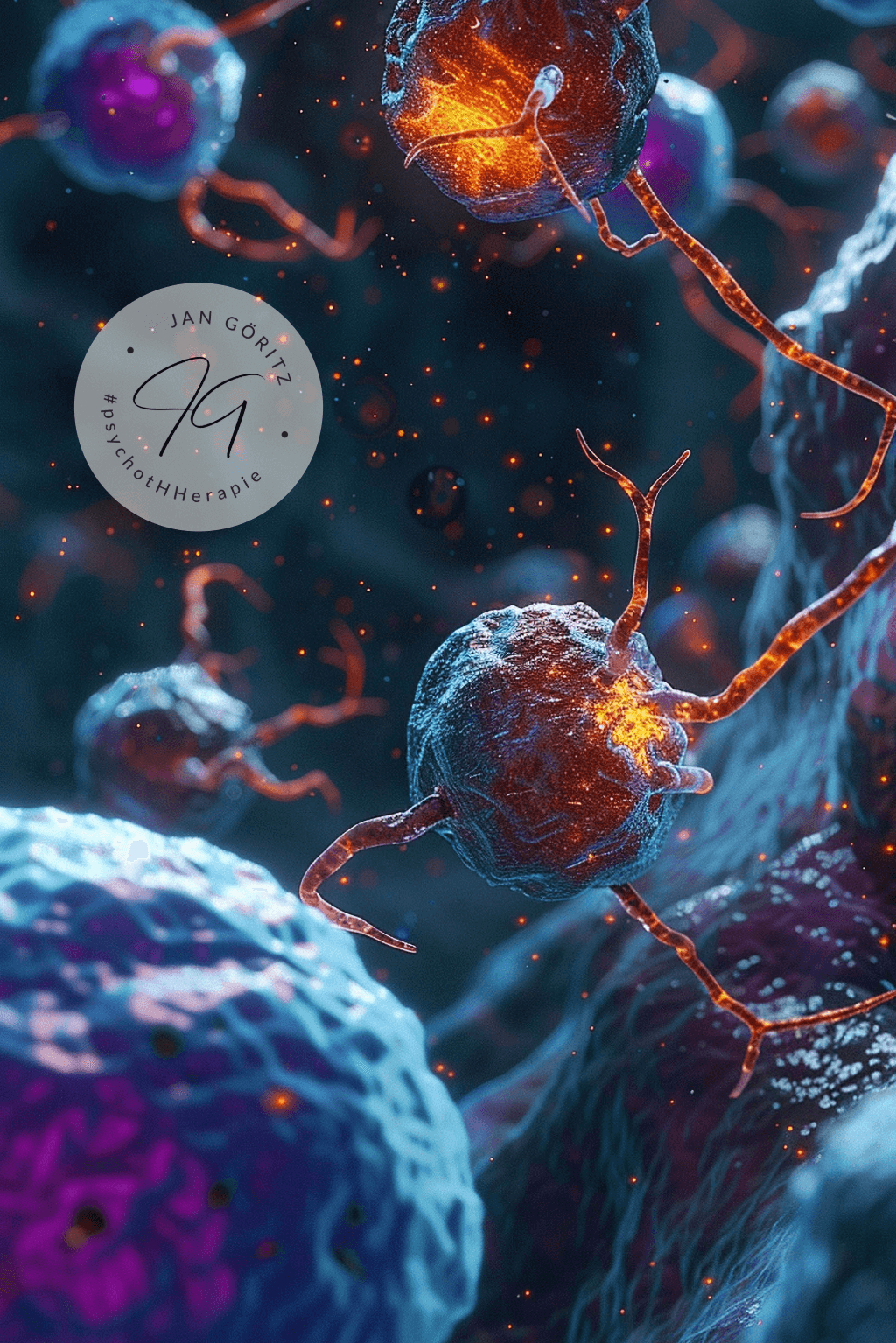
Karl Popper beschreibt in seinem Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ das Paradoxon folgendermaßen: Eine Gesellschaft, die uneingeschränkt tolerant gegenüber jedermann ist – inklusive der Intoleranten –, wird letzten Endes von genau diesen Intoleranten zerstört. Das ist keine Theorie, sondern eine Warnung:
Popper warnt davor, dass man Intoleranz nicht einfach hinnehmen darf, weil das die Freiheit und Offenheit aller bedroht. Der entschiedene Schutz der toleranten Gesellschaft und ihrer Werte ist nötig, auch wenn das heißt, intolerantes Verhalten zu begrenzen, zu ächten oder im Extremfall zu unterdrücken.
In der psychotherapeutischen Praxis zeigt sich dieses Paradoxon sehr praktisch – zum Beispiel bei Frau K., einer Klientin, die stets „tolerant bleiben“ wollte. Im Freundeskreis ließ sie sich Beleidigungen und aggressive Verhaltensweisen gefallen, weil sie nicht „genauso intolerant“ reagieren wollte. Das Ergebnis war erschütternd: Sie wurde zunehmend übersehen und schwieg selbst, ihre Stimme verkümmerte durch grenzenlose Nachgiebigkeit.
In der Therapie lernt Frau K., dass Toleranz nicht Selbstaufgabe bedeutet. Grenzen zu setzen ist ein Akt der Selbstfürsorge – und zugleich ein Beitrag dazu, dass echte Offenheit und Respekt überhaupt möglich bleiben. Diese Balance zu finden, ist eine Grundvoraussetzung für ein gesundes soziales Leben.
Interessant ist, dass dieses Paradoxon sich gut mit der Metapher der „inneren Ampel“ verbinden lässt, wie ich sie hier beschrieben habe. Die Ampel steht für das innere Gespür, wann etwas stimmig ist („grün“) und wann Alarm gegeben werden sollte („rot“).
Das Toleranzparadoxon trifft genau auf diesen Moment: Die Ampel auf Rot sagt, dass jetzt eine Grenze überschritten wird – und dass ein „Weiter so“ nicht mehr der richtige Weg ist. So wie beim Umsteigen in der Bahn, bei dem man genau wissen muss, wann und wo man aussteigt, braucht es im Umgang mit Intoleranz innere Achtsamkeit und klares Handeln.
In unserer Zeit mit polarisierenden politischen Diskussionen, Hass im Internet und gesellschaftlichem Zerfall zeigt sich, dass Karl Popper wohl recht hatte. Uneingeschränkte Toleranz kann Gesellschaften zerreißen, wenn Intoleranz nicht entgegnet wird. Die demokratische Freiheit braucht Schutz durch eine kluge, reflektierte Form der Toleranz, die Grenzen wahrt.
Um das friedliche Zusammenleben zu bewahren, braucht es nicht nur Harmonie beziehungsweise die Idee, nicht mehr anecken zu dürfen, sondern auch entschiedene, klare Impulse.
Aus der Praxis heraus kann ich Ihnen einige hilfreiche Strategien anbieten, die den Umgang mit der Herausforderung des Paradoxons erleichtern:
Manche Menschen, die sich Toleranz auf die Fahne schreiben, laufen Gefahr, ihre eigenen Grenzen aus dem Blick zu verlieren. In etwa so, wie die ehemalige Klientin aus dem oben genannten Beispiel.
In solchen Fällen suchen wir gemeinsam nach einer inneren Instanz, die beim ersten Aufblitzen solcher Gedanken auf einen imaginären Buzzer haut, der dann ein Warngeräusch erzeugt.
Die innere Instanz ist häufig ein real existierender Mensch, und zwar einer, der die betreffende Person wirklich ohne Ansprüche oder Bedingungen liebt oder geliebt hat. Nur ein solcher Mensch hat die Mittel, wirklich zu uns durchzudringen und zu sagen: „Das brauchst du dir nicht gefallen zu lassen!“
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen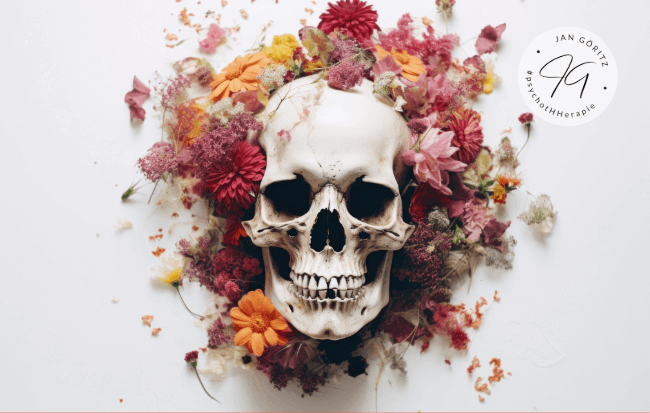
Das Toleranzparadoxon besagt, dass eine grenzenlose Toleranz am Ende zur Zerstörung der Toleranz selbst führt. Wenn eine Gesellschaft auch intoleranten Kräften freie Bahn lässt, riskieren wir, dass diese Kräfte die Demokratie und Freiheit abschaffen.
Nein. Popper betonte, dass es nicht darum geht, unliebsame oder kritische Meinungen zu verbieten. Entscheidend ist, ob diese Meinungen andere ausschließen, diskriminieren oder das demokratische System untergraben wollen. Gegen solche Angriffe braucht es Abwehr.
Man kann intolerante Meinungen aushalten, diskutieren und mit Argumenten entkräften. Erst wenn diese Meinungen in Gewalt, Unterdrückung oder Aufrufe dazu münden, ist es legitim und notwendig, Grenzen zu setzen – zum Beispiel durch Gesetze, Aufklärung oder klare gesellschaftliche Haltung.
Weil viele demokratische Gesellschaften mit Bewegungen konfrontiert sind, die die offene Gesellschaft ausnutzen, um sie abzuschaffen. Das Toleranzparadoxon erinnert uns daran, dass Toleranz kein Selbstläufer ist – sie muss geschützt und verteidigt werden.