Lass mir mein Leben – elterliche Erwartungen und Selbstverwirklichung
Veröffentlicht am: 09.09.2024 von Jan Göritz
Veröffentlicht am: 09.09.2024 von Jan Göritz
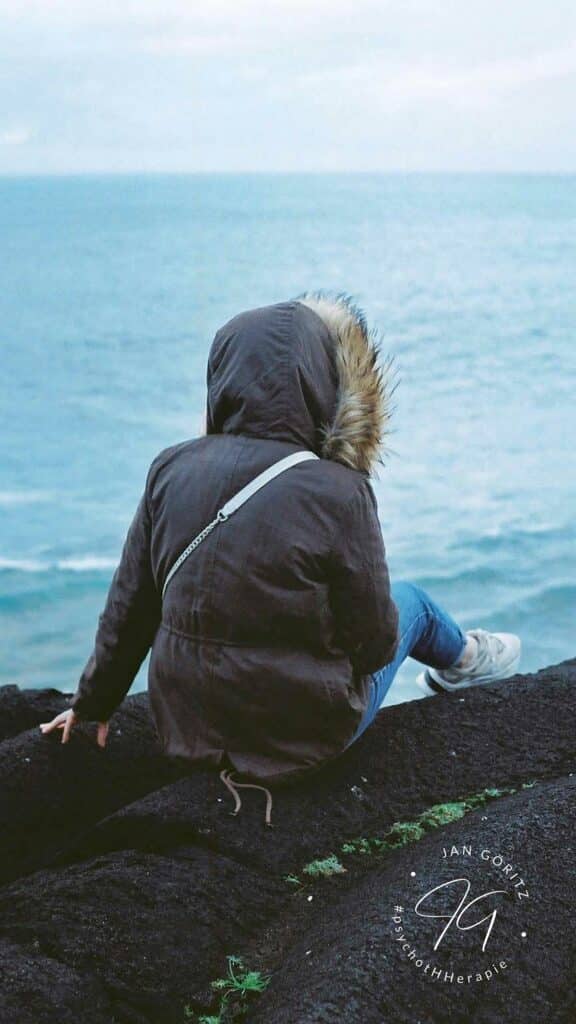
Es ist vielleicht eine merkwürdige Vorstellung, dass Eltern ihren Kindern einen Lebensweg aufzwingen, der vielmehr den eigenen Wünschen entspricht als den Bedürfnissen des Kindes. Das ist natürlich keine Boshaftigkeit, sondern Unachtsamkeit, denn die allermeisten Eltern wollen das Beste für Ihre Kinder. Man könnte auch sagen: „Gut gemeint“ ist das Gegenteil von „gut gemacht“.
Immer wieder beschleicht mich der Gedanke, dass einige Menschen psychische Probleme und schlimmstenfalls sogar Depressionen entwickeln, weil sie versuchen, mit ihrem Leben die unerfüllten Wünsche ihrer Eltern zu erfüllen, auch wenn die elterliche Erwartung nicht explizit geäußert wird.
Es ist bekannt, dass elterliche Erwartungen und Anforderungen bezüglich Bildung und Leistung aufgrund eines zu hohen – und für den Jugendlichen beziehungsweise den jungen Erwachsenen nicht mehr zu regulierenden Drucks – zu Depressionen kommen kann. Unter anderem zeigt dies die Studie „Parental Educational Expectations, Academic Pressure, and Adolescent Mental Health“ auf.
In meiner Beobachtung sind es tatsächlich eher die Kinder, die sich entsprechend unter Druck setzen, um ihren Eltern Dinge zu erfüllen, von denen diese als junge Erwachsene geträumt haben und die sie immer noch als eine gewisse Last mit sich herumtragen.
Ein Klient erzählte mir einmal im Gespräch:
„Es hat mich schon unter einen gewissen Druck gesetzt. Meine Mutter hat mir immer wieder mit trauriger Miene davon erzählt, dass sie immer von einem ausgebauten alten Bulli geträumt hat. Beim Essen hat sie dann von den ganzen Ländern erzählt, die sie damit gerne bereist hätte. Sie tat mir schon leid, als ich noch in die Grundschule ging. Und ungefähr zu der Zeit habe ich mir geschworen, dass ich ihr irgendwann einen Bulli kaufe.“
Natürlich ging es diesem Menschen nicht gut. Er war so sehr auf den Bulli und die Gefühle seiner Mutter fokussiert, dass er überhaupt keinen Bezug mehr zu sich selbst hatte. Als er zum Vorgespräch in meine Praxis kam, wirkte er tatsächlich so, als sei er nur noch die leere Hülle seiner selbst.
Manche Eltern handeln sogar in allerbester Absicht, jedoch identifizieren sie sich so sehr mit dem Kind, dass sie ohne dies zu hinterfragen davon ausgehen, dass ihre Kinder die gleichen Wünsche und Hoffnungen haben, wie sie selbst früher hatten.
So berichtete ein anderer Klient:
„Mein Vater hat es immer gut mit mir gemeint. Er wollte mir das Leben ermöglichen, von dem er immer geträumt hat.“
Das Beispiel dieser Klienten zeigt deutlich, wie schwer es sein kann, den eigenen Weg zu finden, wenn man ständig den Erwartungen anderer hinterherläuft. Es ist, als ob man in einem Marathon antritt, den man nie gewinnen kann, weil das Ziel ständig verschoben wird.
Noch extremer ist die Geschichte eines anderen Klienten. Dieser trug nicht nur exakt den gleichen Namen wie sein Vater und übte denselben Beruf aus, sondern wurde auch gezwungen, die Handschrift seines Vaters zu erlernen. Der Vater hatte seinen eigenen Namen praktisch in den Sohn eingebrannt. Dieser Klient hatte verständlicherweise besonders große Schwierigkeiten, die eigenen Bedürfnisse und Impulse wahrzunehmen. Es schien fast so, als hätte sich dieser Vater der Seele seines Sohnes bemächtigt.
In einer Sitzung schilderte der Klient seine Situation:
„Ich habe immer das Gefühl, dass ich keine eigenen Gedanken habe. Alles, was ich tue, fühlt sich an, als wäre es von meinem Vater vorbestimmt.“
An diesen Worten kann man deutlich sehen, wie stark dieser junge Mann von sich selbst entfremdet war. Er war nur noch eine Projektion seines Vaters,- ohne eigene Wünsche, ohne eigene Impulse.
Solche Fälle sind selten, aber sie verdeutlichen die immense Verantwortung, die Eltern tragen, wenn es darum geht, ihre Kinder zu begleiten und nicht darum, sie zu dominieren.
Nach meiner Beobachtung scheinen insbesondere Kinder aus akademischen Haushalten unter diesem Druck zu leiden. Die Erwartungen, die elterlichen Leistungen mindestens zu wiederholen, wird oft unausgesprochen, aber spürbar – und teils über Generationen hinweg – weitergegeben. Diese Kinder stehen unter Druck wie möglicherweise die eigenen Eltern schon. Lehrer, Arzt, Anwalt – das muss es häufig schon sein, um familiäre Anerkennung zu erhalten.
„Als ich meinen Eltern sagte, dass ich mein Studium schmeiße, weil ich Musiker werden möchte, sah mein Vater mich nur verächtlich an und sagte abfällig: ‚Musiker. Na toll.’ In dem Moment ist die ohnehin nicht sehr stabile Verbindung zu meinen Eltern noch ein bißchen mehr weggebröckelt.“
So erzählte mir ein erfolgreicher Studio-Musiker von der Beziehung zu seinem Vater, nachdem dieser verstorben war und sich der lange verdrängte Schmerz wieder bemerkbar machte.
Wenn man jetzt denkt, dass absolute Freiheit, also auch von elterlichen Erwartungen, in der Lebensgestaltung für Kinder die Lösung ist, täuscht man sich. Auch diese Form der Erziehung hat ihre Tücken. Absolute Freiheit kann von Kindern, die ja auf eine gewisse Führung angewiesen sind, als Gleichgültigkeit interpretiert werden. Auch Menschen, die in solchen Verhältnissen aufgewachsen sind, suchen mitunter Hilfe. Sie fühlen sich oft minderwertig, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sich selbst ihre eigenen Eltern nicht für sie interessiert haben.
In einer Sitzung erzählte mir eine Klientin:
„Meine Eltern haben mich immer machen lassen, was ich wollte. Anfangs dachte ich, das sei großartig. Aber irgendwann wurde mir klar, dass ihnen egal war, was ich tat. Sie haben nie nachgefragt, nie Interesse gezeigt. Das hat mich tief verunsichert.“
Die Verunsicherung, die durch völlige Freiheit entsteht, kann genauso belastend sein wie der Druck, den Lebensentwurf der Eltern zu erfüllen. Diese Menschen haben oft Schwierigkeiten, sich selbst zu motivieren und sinnvolle Ziele zu setzen, weil sie nie gelernt haben, sich an gesunde Grenzen zu halten.
Der Weg, ein Kind ins Leben zu begleiten und es sich entwickeln zu lassen, kommt also nicht ohne Grenzen aus. Es geht nicht um Grenzen, die „vernünftig“ oder „logisch“ erscheinen, sondern darum, das Kind zu erfassen und ihm genau den Verantwortungsrahmen zu bieten, den es auch ausfüllen kann. Das Kind darf und sollte gefordert werden, aber es sollte nicht überfordert sein.
Ein gesundes Maß an elterlicher Führung hilft dem Kind, ein stabiles Fundament für seine Zukunft aufzubauen. Gleichzeitig muss genug Raum für eigene Entfaltung und Selbstverwirklichung bleiben. Es ist ein Balanceakt, der viel Fingerspitzengefühl erfordert und immer wieder nachjustiert werden muss, da es in einer Familie keinen Stillstand gibt.
Es ist essenziell, dass Eltern die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kinder erkennen und respektieren. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch sollte sich und seine Stärken individuell entwickeln können.
Sie können Angebote machen, aber vermeiden Sie nach Möglichkeit, Ihre unerfüllten Wünsche und Träume auf Ihr Kind zu projizieren. Der Dialog zwischen Eltern und Kind ist entscheidend: Sprechen Sie über Wünsche, Ängste und Ziele. Denn über eine offene Kommunikation kann ein Umfeld geschaffen werden, in dem Kinder zu selbstbewussten und glücklichen Erwachsenen heranwachsen können.
Hören Sie genau hin, was Ihre Kinder sagen. Oft sind ihre Bedürfnisse klarer, als es auf den ersten Blick scheint. Die Kunst liegt darin, diese Bedürfnisse zu erkennen und ihnen Raum zu geben, ohne die eigene Rolle als Begleiter und Unterstützer aus dem Blick zu verlieren.
1. Selbstreflexion und Bewusstsein: Der erste Schritt besteht darin, sich der Auswirkungen bewusst zu werden, die diese Erwartungen auf Ihr Selbstbild und Ihre Lebensentscheidungen haben. Indem Sie sich Ihrer eigenen Gedanken und Gefühle bewusst werden, können Sie beginnen, diese Muster zu erkennen und zu hinterfragen.
2. Akzeptanz und Loslassen: Es ist wichtig, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Erwartungen Ihrer Eltern nicht zwangsläufig Ihre eigenen sein müssen. Sie haben das Recht, Ihren eigenen Weg zu wählen und sich von den Erwartungen zu lösen, die Ihnen nicht guttun. Dies kann ein langer Prozess sein, der jedoch zu größerer innerer Freiheit führt.
3. Grenzen setzen: Lernen Sie, gesunde Grenzen zu setzen, sowohl in Bezug auf Ihre eigenen Ansprüche als auch im Umgang mit Ihren Eltern. Dies bedeutet, klar zu kommunizieren, was für Sie wichtig ist und was nicht, und sich nicht mehr von den Erwartungen anderer definieren zu lassen.
4. Therapeutische Unterstützung: Falls die Belastung durch diese Erfahrungen sehr tief sitzt, kann es hilfreich sein, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ein Therapeut kann Ihnen dabei helfen, alte Wunden zu heilen und neue, selbstbestimmte Lebensperspektiven zu entwickeln.
5. Selbstwert und Selbstfürsorge stärken: Arbeiten Sie aktiv daran, Ihr Selbstwertgefühl unabhängig von äußeren Erwartungen zu stärken. Indem Sie sich selbst so annehmen, wie Sie sind, und sich um Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche kümmern, schaffen Sie die Grundlage für ein erfüllteres und authentischeres Leben.
