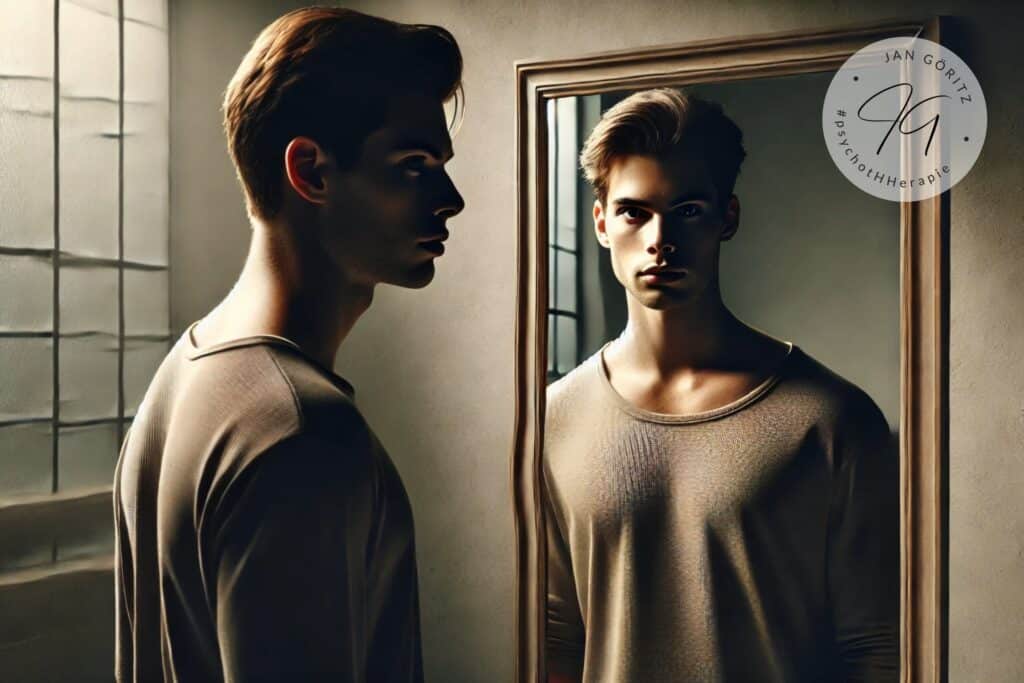Macht? Nix. – Teil 1: Kontrolle
Veröffentlicht am: 16.06.2025 von Jan Göritz
Veröffentlicht am: 16.06.2025 von Jan Göritz

Macht. Alleine das Wort klingt schon hart und nach Kontrolle. Der König, vor dem alle niederknien, ist vielleicht ein passendes Bild. In politischen, wirtschaftlichen, aber auch in gesellschaftlichen Kontexten: ob Eltern, Lehrer, Chefs oder Politiker – Macht ist mehr oder weniger überall dabei.
Wer das Geld hat, hat die Macht.
Und wer die Macht hat, hat das Recht!
(Ton Steine Scherben)
Aber ist Macht wirklich so negativ konnotiert, wie viele Menschen meinen? Müssen wir zwischen verschiedenen Arten von Macht differenzieren? Und was bedeutet Macht eigentlich im psychologischen und psychotherapeutischen Kontext?
Wenn Sie an negative Machtausübung denken: Was sehen Sie dann vor Ihrem inneren Auge? Einen cholerischen Chef? Die Mutter, die mit Schweigen straft? Einen Politiker, der den Bezug zur eigenen Menschlichkeit verloren hat?
Alle drei (und es gibt leider noch viel mehr Beispiele) eint eine Gemeinsamkeit: Es geht darum, andere Menschen zu manipulieren, zu dominieren oder zu unterwerfen. Was im ersten Augenblick stark und machtvoll wirkt, hat Wirklichkeit kaum etwas mit echter Stärke zu tun. Die Triebfeder hinter solchem Verhalten ist in der Regel Angst!
Der Klient, Anfang 30, ein ruhiger, sensibler Typ, kam ursprünglich wegen Erschöpfung und innerer Leere zu mir, vermeintlich lag es am unpassenden Job. Im Vorgespräch zeigte sich bereits ein Glaubenssatz, der in Richtung „Ich bin unfähig“ zeigte.
Nach einigen Sitzungen offenbarte sich, dass nicht der Job der Stressfaktor war…
Wer vertraut, muss nicht kontrollieren
Er berichtete mir: „Meine Mutter ruft jeden Tag an. Wenn ich nicht rangehe, schickt sie mir fünf Sprachnachrichten. Immer mit so einem komischen Unterton. Mal fordernd, mal weinerlich. Das ist doch nicht normal, oder?“
Das war übrigens keine rhetorische Frage. Er wusste wirklich nicht mehr, was normal war und was nicht. Er fühlte sich ständig emotional verfügbar, beobachtet und permanent gestresst.
„Ich bin doch damals extra mehrere 100 Kilometer weit weggezogen, weil ich mich frei fühlen wollte. Aber ich fühle mich wie an so einer ausziehbaren Hundeleine. Und sie kann jederzeit auf den Knopf drücken und zack!“ er macht eine Geste, als würde er zwischen seinen Händen ein Stück Seil stramm ziehen.
Die Mutter war das, was in der systemischen Therapie oft als „symbiotisch vereinnahmend“ beschrieben wird. Sie hatte sich emotional an ihren Sohn gebunden, als wäre er ein Teil von ihr – ohne klare Trennung zwischen ihrem eigenen Befinden und seinem Leben.
Und er?
Er fiel immer wieder in die Rolle des kleinen Jungen zurück: „Wenn sie mich anschreit oder anfängt zu weinen, dann entschuldige ich mich manchmal, obwohl ich gar nichts gemacht habe.“
„Was passiert in Ihnen, wenn sie Sie so behandelt?“
„Es wird sofort eng in der Brust, ich bekomme kaum noch Luft. Ich will einfach nur weg. Aber ich sage dann irgendwas, was sie beruhigt. Nur, damit es schnell vorbei ist.“
„Das klingt nach einem alten Überlebensmuster. Aber häufig ist es so, dass uns die Strategien, die wir als Kinder entwickelt haben, als Erwachsene auf die Füße fallen.“
Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. (Abraham Lincoln)
Er lässt die Worte sacken und sagt dann in einem nachdenklichen Tonfall: „Sie meinen, wenn ich so reagiere wie früher, werde ich auch immer der von früher bleiben?“
Auf mein langsames Nicken reagiert er mit einem Ruck durch den ganzen Körper: „Dann brauche ich eine Erwachsenen-Strategie!“ – und schlug zur Bekräftigung seine Faust auf die Armlehne. „Wenn man an ‘Mutter‘ denkt, hat man ja eigentlich etwas Liebevolles vor Augen, oder?“ – ich nickte, gespannt, was jetzt kommen würde – „Aber wenn ich an meine Mutter denke, bekomme ich regelrecht Angst. Als ob ich an eine Bedrohung denken würde.“
Diese Thematik beschäftigte uns mehrere Sitzungen. Besonders der Teil des inneren Kindes, der Teil, der nach wie vor Angst davor hat, niemals die Liebe der Mutter zu bekommen, die er so dringend braucht, stand im Mittelpunkt.
Der Klient übernahm die Verantwortung für diesen Anteil und damit auch für seine Gefühle wie Angst oder Sehnsucht.
Irgendwann fragte ich ihn: „Was würden Sie sagen, wenn Ihre Mutter Sie heute wieder anruft?“
Er überlegte kurz, und dann sagte er, in einem ruhigen, fast entspannten Tonfall: „Ich will nicht mehr! Ich will dich und diese manipulativen Spiele nicht mehr! Ich will keine Vorwürfe mehr hören und keine Schuldgefühle mehr haben! Steck dir deine Kontrolle sonstwo hin! Ich stehe jedenfalls nicht mehr zur Verfügung!“
Ich konnte mir ob der plötzlich aufblühenden Lebendigkeit meines Klienten ein Schmunzeln nicht verkneifen und fragte weiter: „Wenn Sie ihr das so sagen würden – wie würde sie reagieren?“
Er schwieg und lies den Blick durch die Wände meiner Praxis in die Ferne schweifen. Dann war er plötzlich sehr präsent: „Sie würde sagen – und zwar wortwörtlich: ‚du bist ein undankbares Arschloch! Ich hab so viel für dich getan, und das ist jetzt der Dank?! Du machst mich kaputt, du Nichtsnutz. Wenn ich irgendwann tot bin, dann weißt du ganz genau, dass du schuld bist!‘“
Als er fertig war, wischte er sich mit dem Zeigefinger Tränen aus den Augen.
In diesem Moment erkannte ich, dass sein inneres Band zur Mutter gerade getrennt wurde, und zwar endgültig! Jetzt hat er den Raum und die Freiheit, die er zum Wachsen braucht.
Nach einer Zeit des reiflichen Überlegens entschied sich dafür, einen Brief zu schreiben.
Die Freiheit lieben heißt andere lieben; die Macht lieben, sich selbst lieben. (William Hazlitt)
Es sollte kein emotionaler Brief werden, nicht anklagend und nicht wütend. Er wollte einen ruhigen und klaren Brief schreiben – an sich selbst.
In diesem Brief formulierte er Verständnis, schrieb, was er braucht und wer er ist, und versicherte sich selbst, dass er wachsen möchte, erwachsen werden möchte. Außerdem erkannte er in diesem Brief, dass er zum Wachsen Raum braucht, den er niemals haben wird, solange er Kontakt zu seiner Mutter hat.
Die erste Zeit ohne Kontakt war merkwürdig für ihn. Er fühlte sich zwar „irgendwie frei“, aber der von ihm erhoffte Knalleffekt blieb aus.
Stattdessen fühlte er sich unruhig, er zweifelte und hatte bisweilen auch Schuldgefühle. Es war kein einfacher Cut. Es war ein bewusster, therapeutisch begleiteter Prozess. Der emotionale Kontaktabbruch bedeutete:
• Keine täglichen Telefonate mehr.
• Keine Reaktion auf Schuldzuweisungen.
• Keine Erklärung, keine Rechtfertigung.
Und endlich einfach Ruhe und Raum für sich. Und in diesem Raum konnte er endlich wachsen.
Ein paar Wochen später berichtete er in einer Sitzung:
„Anfangs war es ganz schlimm. Ich habe mich wie ein Verräter gefühlt, aber jetzt … Ich komm’ gedanklich wieder zur Ruhe und kann abends einschlafen, ohne das Echo ihrer Vorwürfe zu hören. Das war eigentlich das Schlimmste: Ich konnte keinen Schritt machen, ohne dass ich mich selbst durch ihre Augen gesehen und nach ihren Maßstäben bewertet habe.“
Durch das Reduzieren des äußeren Kontakts bröckelte auch die Repräsentanz der Mutter in seinem Inneren. So entstand immer mehr Platz für seine wahren Persönlichkeitsrechte.
Ein Kontaktabbruch kann also die eigene Heilung fördern, auch wenn er sich anfangs – wie auch in diesem Fall – brutal anfühlt.
Selbstermächtigung – der Titel des 2. Teils – kann also durchaus mit massiven inneren Kämpfen einhergehen. Aber ich habe noch keinen Klienten erlebt, der aus diesen Kämpfen nicht gestärkt hervorgegangen ist.
Teil 2 lesen Sie hier (Selbstermächtigung).