Hass – was ist das eigentlich?
Veröffentlicht am: 02.06.2025 von Jan Göritz
Veröffentlicht am: 02.06.2025 von Jan Göritz
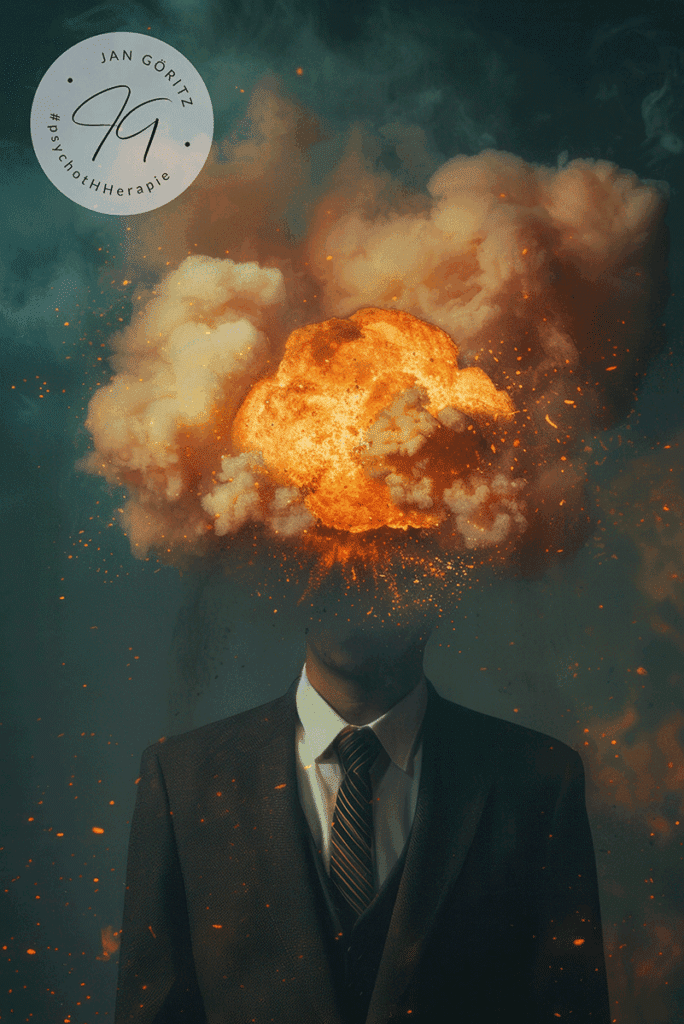
Foto: © Elzerl / Adobe Stock
Woran denken Sie, wenn sie an „Hass“ denken? Für die meisten Menschen ist er wahrscheinlich laut und zerstörerisch. Komischerweise finden wir ihn trotzdem an allen Ecken und Enden:
Aber woher kommt er eigentlich? Und was ist er? Eine Emotion? Eine Charaktereigenschaft? Etwas ganz anderes?
Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid (Meister Yoda)
Auf jeden Fall erfüllt er die Funktion eines Schutzpanzers, der es uns ermöglicht, auch dann nach außen stark zu wirken, wenn es in unserem Inneren eigentlich ganz anders aussieht.
Aus meiner psychotherapeutischen Arbeit heraus kann ich sagen: Hass ist ein gut sichtbares Symptom einer inneren Not beziehungsweise Überforderung.
Manchmal kommen Klienten mit Hass auf irgendetwas oder irgendjemanden zu mir in die Praxis.
Wenn wir uns dann gemeinsam auf die Entdeckungsreise begeben, was dahintersteht, dann stoßen wir meistens auf eher „schwache“ Gefühle wie Ohnmacht, Angst oder Scham.
Hass ist da lediglich eine Reaktion. Allerdings keine Reaktion auf aktuelle Situationen, sondern auf Gefühle, die ihren Ursprung häufig in unserer Kindheit oder Jugend haben.
Wenn ein Mensch hasst, hat das in der Regel eine Vorgeschichte:
Wisset, die euch Hass predigen, erlösen euch nicht. (Marie von Ebner-Eschenbach)
Das bedeutet, es handelt sich nicht um ein spontanes Gefühl, wie Freude, Wut oder Trauer ist. Hass ist genau genommen gar kein Gefühl, sondern eine innere Konstruktion. Man könnte sagen, es handelt sich um emotionale Selbstverteidigung.
Ein besonders gefährlicher Aspekt von Hass ist die sogenannte Dehumanisierung – also das psychische Abschalten unserer Fähigkeit, das Gegenüber noch als fühlenden, gleichwertigen Menschen wahrzunehmen. Wer hasst, reduziert andere auf ein Feindbild, auf ein Etikett, auf „die da“, „solche Typen“ oder „alle Frauen/Männer/Ausländer/Eltern“.
Damit wird etwas Wesentliches verhindert: Mitgefühl.
Denn Mitgefühl braucht Nähe, braucht Gemeinsamkeit – Hass lebt dagegen von Spaltung. Und genau das macht ihn so mächtig – und so destruktiv.
Psychologisch betrachtet ist Dehumanisierung ein Abwehrmechanismus, der dabei hilft, das eigene Verhalten nicht hinterfragen zu müssen. Wer „die anderen“ als weniger menschlich empfindet, muss sich nicht mehr mit ihrer Verletzlichkeit auseinandersetzen – und auch nicht mit der eigenen.
Ein 34-jähriger ehemaliger Klient kam wegen immer wiederkehrender Beziehungskrisen zu mir. Seine Partnerschaften verliefen im Großen und Ganzen stets nach demselben Muster: anfangs loderte die große Liebe, alles war intensiv und wirkte manchmal etwas idealisiert.
Hass ist die Rache des Feiglings dafür, dass er eingeschüchtert wurde. (George Bernard Shaw)
Nach kurzer Zeit kippt dann aber die Stimmung. Er fühlte sich immer öfter eingeengt und missverstanden. Manchmal vermutete er, von seiner Partnerin ausgenutzt zu werden.
Früher oder später begann er, abwertend über seine Partnerinnen zu sprechen. Einmal sagte er, sarkastisch lächelnd: „Frauen sind nur anstrengend. Warum ziehe ich immer die Verrückten an?“
Dieses Motiv wiederholte sich, immer wieder war „die Frau“ schuld:
Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass er dazu neigt, dazu pauschalisieren und generalisieren, er reagierte mit einer Abwehr: „Ich hab das häufig genug mitbekommen und allmählich wirklich die Schnauze voll.“
Es wurde schnell deutlich, dass er eigentlich tief verletzt war, genau genommen trug er immer noch an Verletzungen aus der Kindheit. Er wuchs mit einer emotional distanzierten Mutter auf, die von Nähe überfordert war und mit Kälte und Ignoranz strafte, wenn er sich von ihr zurückzog.
Seine Vorurteile gegen Frauen waren also ein kindlicher Versuch, erneute Verletzungen zu vermeiden.
Er hat aus seiner Kindheit den Glaubenssatz mitgenommen: „Ich bin nicht liebenswert und werde sowieso wieder enttäuscht.“
Er tat nach Kräften, alles dafür, den tiefen Schmerz aus seiner Kindheit, bestehend aus Enttäuschung, Ohnmacht und Angst vor Nähe, nie wieder spüren zu müssen. Und dafür musste ein mächtiges Bollwerk installiert werden: Hass.
Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie. (Aldous Huxley)
Die Psychologie spricht hier von sekundären Emotionen oder emotionalen Reaktionsketten.
Die Forscherin Lisa Feldman Barrett betont, dass unsere Emotionen nicht fix sind, sondern, basierend auf Erfahrung und Kontext, konstruiert werden.
Der deutsche Psychotherapeut Prof. Dr. Franz Ruppert spricht in diesem Zusammenhang von „Überlebensstrategien der Psyche“, zu denen auch destruktive Gefühle gehören können.
Hass ist also eine Strategie und keine Grundemotion.
Ein kleines Kind kann schreien, toben, treten – und sich zehn Minuten später wieder in Ihre Arme kuscheln. Das klingt nicht nach Hass.
Hass ist eine kognitive Leistung, die Kinder noch nicht erbringen können.
Denn Hass braucht ein Ich-Bewusstsein
Er setzt voraus:
• Ein relativ stabiles Selbstbild
• Die Fähigkeit zur Abgrenzung („Du bist schuld an meinem Gefühl“)
Geistlose kann man nicht begeistern, aber fanatisieren kann man sie. (Marie von Ebner-Eschenbach)
• Kognitive Konstruktion von Feindbildern
• Langfristige emotionale Erinnerung
All das entwickelt sich erst im Laufe der Kindheit – und ist frühestens mit etwa 7 Jahren stabil. Die Psychologin Margot Sunderland beschreibt in ihrem Buch The Science of Parenting, dass Kinder unter 6 Jahren primär limbisch reagieren – also mit unmittelbaren Gefühlen wie Wut, Traurigkeit, Freude.
Hass ist dagegen ein „konstruiertes Gefühl“, das Denken und Erinnern voraussetzt. Deshalb können Kinder in dem Sinne nicht hassen – selbst wenn es sich für Erwachsene manchmal so anfühlt.
Ein Beispiel:
Ein 5-jähriges Mädchen ruft: „Ich hasse dich, Mama!“
Was sie eigentlich sagt: „Ich bin überfordert, traurig und enttäuscht – aber ich habe keine Worte dafür.“
Wird ihr in diesem Moment Empathie entgegengebracht, beruhigt sie sich meist schnell. Hass, im Sinne einer tief verwurzelten und länger anhaltenden Ablehnung, entsteht hier nicht – nur eine zeitlich begrenzte emotionale Überforderung.
Hass ist nicht das Problem – sondern ein Hinweis auf ein ungelöstes Problem. Er zeigt meistens, dass da etwas ist, das Sie (noch) nicht fühlen konnten beziehungsweise wollten. Etwas, das einst zu viel war. Zu schmerzhaft, zu beschämend, zu überfordernd.
Wenn Sie sich selbst oder andere dabei ertappen, wie er das Ruder übernimmt, fragen Sie sich:
Was wird hier eigentlich verteidigt? Welche Wunde liegt darunter?
Therapie ist kein Ort, an dem Hass „verboten“ wird. Sondern ein Raum, in dem sichtbar werden darf, was er eigentlich verdeckt. Und manchmal ist das der erste Schritt zu echter innerer Freiheit.
Hass ist kein Endzustand. Er ist ein Prozess – und genau das ist auch Ihre Chance. Wenn Sie merken, dass er sich in Ihnen festsetzt, gibt es Wege, um wieder Verbindung zu sich selbst und zu anderen zu finden.
Hier sind einige bewährte Strategien aus der therapeutischen Praxis:
Wir sollten niemals aus den Augen verlieren, dass der Weg zur Tyrannei mit der Zerstörung der Wahrheit beginnt. (Bill Clinton)
Statt „Ich hasse ihn!“ hilft oft ein Schritt zurück:
„Ich fühle mich verletzt, ohnmächtig oder enttäuscht.“
Allein das schafft Abstand und öffnet die Tür zur Selbstempathie.
Woher kommt dieses Gefühl? Welche alten Erfahrungen könnten hier „mitsprechen“?
Tagebuchschreiben, therapeutische Gespräche oder kreative Ausdrucksformen können helfen, die innere Dynamik zu entschlüsseln.
Ein zentraler Schritt hinaus führt über die Umkehr der Dehumanisierung: Sich selbst und andere wieder als Menschen sehen. Mit Geschichten. Mit Prägungen. Mit Unsicherheiten und Verletzungen.
Das bedeutet nicht, alles gutzuheißen oder sich selbst aufzugeben. Es bedeutet, die Vereinfachung aufzugeben. Aus „Die ist irre“ wird „Sie war mit meinen Bedürfnissen überfordert.“ Aus „Der ist ein Arschloch“ wird „Er konnte mit Nähe nicht umgehen.“
Das ist unbequem – aber menschlich – und es öffnet die Tür zu Veränderung.
Was gibt Ihnen Kraft, ohne zu spalten? Bewegung, Musik, Gemeinschaft, vielleicht eine Form von Aktivismus, der verbindet statt zerstört?
Therapie ist kein Zeichen von Schwäche – sondern von Selbstfürsorge. Wer lernt, mit verletzlichen Gefühlen umzugehen, braucht keinen Hass mehr als Rüstung.
Hass zeigt Ihnen, dass etwas in Ihnen gesehen werden will. Nicht von der Welt – sondern von Ihnen selbst.
Es ist manchmal ein schwerer Weg, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen – aber wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, tun Sie nicht nur etwas für sich. Sie übernehmen auch noch Verantwortung für die Gemeinschaft, in der Sie Leben. Ihre Familie, Ihre Nachbarschaft, Ihre Stadt … wie Laotse schon sagte:
Willst du die Welt verändern, dann verändere dein Land.
Willst du dein Land verändern, dann verändere deine Stadt.
Willst du deine Stadt verändern, dann verändere deine Straße.
Willst du deine Straße verändern, dann verändere dein Haus.
Willst du dein Haus verändern, dann verändere dich.

Foto: © Stocksnapper / Adobe Stock