Anpassung bis zur Selbstverleugnung (Teil 1)
Veröffentlicht am: 20.10.2025 von Jan Göritz
Veröffentlicht am: 20.10.2025 von Jan Göritz
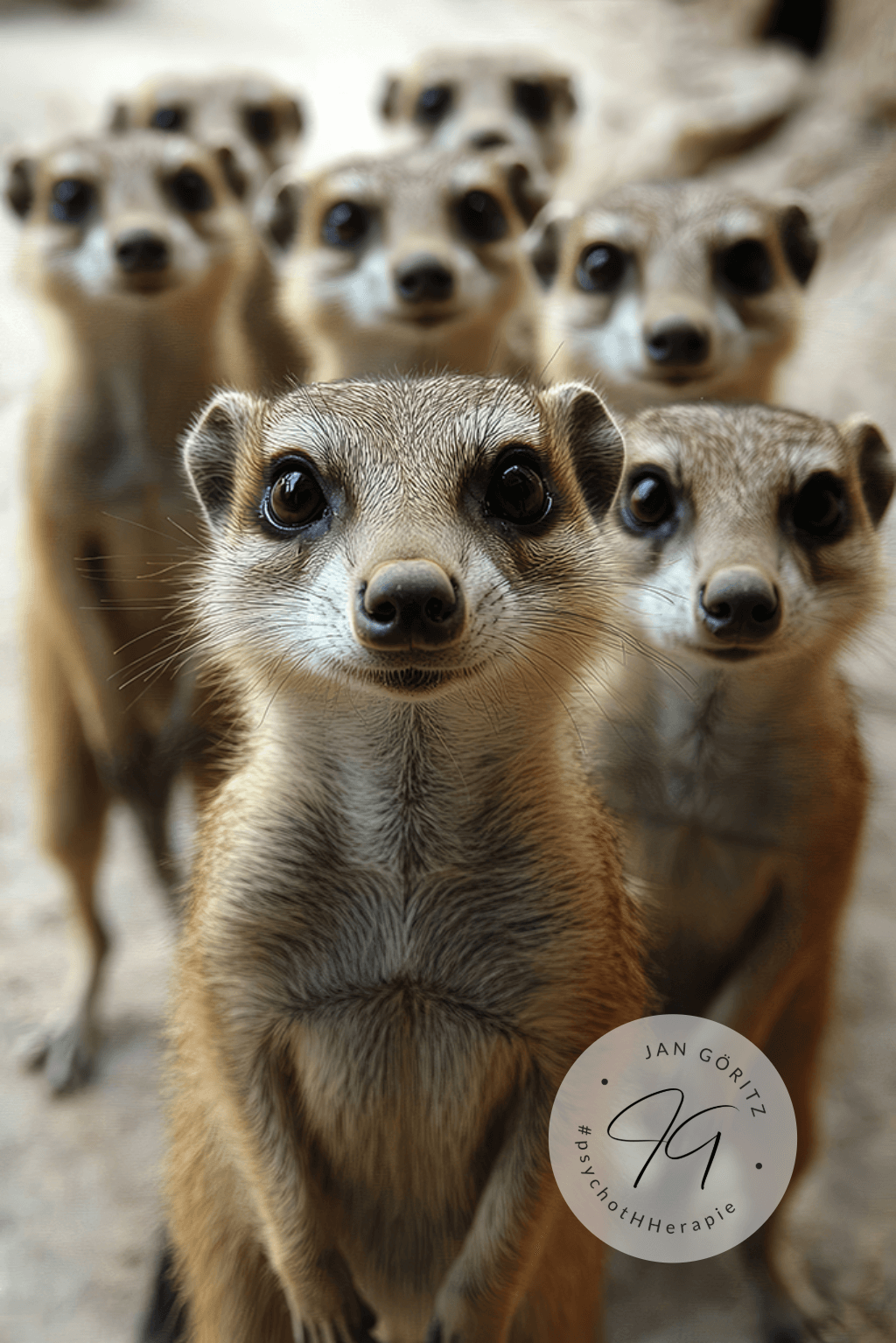
„Ich denke, also bin ich“, schrieb René Descartes im 17. Jahrhundert und legte damit das Fundament des modernen Selbst.
Heute klingt das anders:
Ich gehöre dazu, also bin ich.
Das 21. Jahrhundert hat das Denken durch das Streben nach Zugehörigkeit ersetzt.
Identität entsteht nicht mehr unbedingt durch Bewusstwerdung, sondern durch das soziale Feedback. Ist man von diesem Feedback abhängig, dann muss man darauf achten, dass keine Selbstverleugnung entsteht.
Wer bin ich?
Die Antwort lautet oft:
Ich bin Teil einer Gruppe, einer Bewegung, eines Teams, einer Szene:
Ich bin links, liberal, nachhaltig, queer, spirituell, ironisch oder wütend.
Ich bin also definiert und vermeide dadurch jegliche Ambivalenz.
Einfach nur sein scheint heute nicht mehr zu genügen. Möglicherweise verunsichert es andere Menschen, wenn man ihnen keine „Anleitung“ für sich selbst an die Hand gibt.
Vielleicht haben wir vergessen, was es bedeutet, Mensch zu sein und sich gegenseitig entsprechend zu behandeln.
Einfach nur zu sein, beziehungsweise das Dasein anderer auszuhalten, scheint für viele Menschen anstrengend geworden zu sein.
Doch es ist existenziell, sich mit dem eigenen Dasein auseinanderzusetzen. Mit den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Grenzen.
Ansonsten werden wir manipulierbar, denn wenn unsere innere Ampel ausgefallen ist und unser moralischer Kompass vor sich hin kreiselt: Wonach richten wir uns dann?
Vermutlich nach den am besten klingenden Versprechen und einfachen Lösungen für komplexe Probleme.
„Wer sind Sie, wenn alles um Sie herum wegbricht?“
Bestimmt eine unangenehme Frage. Aber tun Sie sich mal hin und versuchen Sie, die Frage zu beantworten.
Das Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, war früher ein ganz existenzielles Bedürfnis. Es war ganz einfach: Gehören Sie dazu, haben Sie den Schutz der Gruppe. Gehören Sie nicht dazu, sind Sie auf sich alleine gestellt. Nahrung und Schutz wurden nicht auf die verschiedenen Schultern des Stammes verteilt, sondern in diesem Fall mussten Sie sich um alles alleine kümmern.
Das erklärt vielleicht, warum so viele Menschen lieber schweigen, als zu riskieren, dass sie anecken. Oder dass Menschen Kompromisse eingehen, die nichts anderes sind, als Verrat an sich selbst.
Wir dürfen allerdings nicht außer Acht lassen, dass Ablehnung im Gehirn, die gleichen Areale anspielt, wie Schmerz durch körperliche Verletzung. Auch das ist verständlich.
Schwierig wird es da, wo wir beginnen, uns grundlegend selbst zu verleugnen. Und das ist dann der Fall, wenn wir uns von unserer Angst leiten lassen und nicht mehr auf unsere innere Stimme hören (können). Das ist Selbstverleugnung.
Wenn Denken, Handeln und Fühlen auseinanderdriften, wir also gerade dabei sind, uns selbst zu verlieren, dann sprechen wir von Inkongruenz. Dieser auf Carl Rogers zurückgehende Begriff, lässt sich gut an einem Beispiel verdeutlichen:
Sie sitzen mit Freunden zusammen und Sie werden Ziel eines passiv-aggressiven Witzes, der Sie sehr verletzt.
Alle lachen und Sie lachen halbherzig mit, um nicht wieder als empfindlich zu gelten.
Danach fühlen Sie sich leer und leicht beschämt.
Oder kurz gesagt:
„Alles gut“ nach außen und innen herrscht Überforderung.
Je stärker unser System aus Denken, Fühlen und Handeln auseinanderdriftet, desto größer ist die Selbstverleugnung.
Wir funktionieren noch, aber wir leben nicht.
Einige Klientinnen und Klienten wenden sich an einem ähnlichen Punkt an mich, und es kommt nicht selten vor, dass im Vorgespräch die Antwort auf die Frage nach dem Anliegen meines Gegenübers den Satz „irgendwie weiß ich gar nicht mehr richtig, wer ich bin“ beinhaltet.
„Harmonie ist mir das Allerwichtigste, Herr Göritz. Da kann ich jetzt doch nicht hingehen und meinen Eltern die Meinung sagen…“
Herr Müller sitzt fast schon verzweifelt vor mir. Er hat davon berichtet, wie sehr ihn seine Mutter in Kindheit und Jugend verletzt hat. Er hat sich schon früh im Leben ungeliebt gefühlt, weil seine Mutter seine Schwestern so offensichtlich bevorzugt hat, dass sich immer wie ein „Aschenputt“ gefühlt hat. „Das hatte ich mir damals als männliche Form von Aschenputtel überlegt.“
Und es war tatsächlich ähnlich wie im Märchen: Die Schwestern hatten immer tolle Klamotten, während er vom „Grabbeltisch“ eingekleidet wurde. Bei Ausflügen wurde er bei der Nachbarin „abgestellt“, und essen musste er, seit er ein kleiner Junge war, alleine in der Küche.
Und nun sitzen wir uns gegenüber, die Luft im Raum knistert förmlich vor angestauter Wut, aber Herr Müller beginnt, seine Eltern zu verteidigen: „Sie waren mit mir ja auch überfordert. Ich war schon ein schwieriges Kind..“
„Herr Müller, wo ist denn Ihre Wut?“ frage ich ihn.
„Wut? Nein, echt nicht. Das ist ja vorbei und es sind einfach auch ganz tolle Menschen.“ Ich sehe ein mildes Lächeln und spüre ein inneres Brodeln.
Noch kann Herr Müller die Selbstverleugnung nicht sehen, die Verdrängung der Wut ist über die Jahre zu einem Automatismus geworden.
Ein paar Wochen später – wir haben über das innere Kind geredet und darüber, dass emotionale Ambivalenzen schwer auszuhalten sind, sie aber trotzdem Teil des Lebens sind – hat er es das erste Mal geschafft, dem „kleinen Claus“ eine Stimme zu geben: „Ich finde das ungerecht, dass Carola und Carmen immer Ausflüge mit euch gemacht haben und ich musste zu Frau Bernecker.“
Das war der erste Schritt raus aus der Selbstverleugnung.
Hinter Selbstverleugnung steckt selten Feigheit. Im Gegenteil: Meist handelt es sich um eine Überlebensstrategie aus der Kindheit. Ein Kind, das spürt, dass seine Wut, seine Traurigkeit oder sein Eigensinn unerwünscht sind, lernt, dass es so nicht richtig ist. Also macht es sich passend.
Früher waren wir alle von unseren Eltern abhängig. Deswegen mussten wir dafür sorgen, dass wir nicht „verstoßen“ werden. Die Angst vor dem Verstoßenwerden sitzt bei vielen von uns übrigens tief verankert. Aber wie so häufig bei kindlichen Überlebensstrategien: Als Erwachsene fallen sie uns auf die Füße.
Da geht es nicht mehr um Zugehörigkeit, sondern um ständige Rücksicht, Harmoniesucht oder innere Leere.
Ich habe es oben schon angerissen:
Ansonsten werden wir manipulierbar, denn wenn unsere innere Ampel ausgefallen ist und unser moralischer Kompass vor sich hin kreiselt: Wonach richten wir uns dann?
Was also passiert, wenn jemand sich dauerhaft selbst verleugnet und eigene Wünsche, Werte oder Überzeugungen immer verdrängt? Dann entsteht ein inneres Vakuum. Und ein Vakuum ist nicht wählerisch, mit was es gefüllt wird. Alles ist besser, als dieses unerträgliche Nichts. Häufig sind es die „Lauten“, die unsere Aufmerksamkeit bekommen. Und die Lauten sind nicht selten die Radikalen.
Radikalisierung beginnt also selten direkt mit Hass, sondern mit Orientierungslosigkeit und dem Wunsch nach Bedeutung und Anerkennung.
Wer sich selbst nicht mehr finden kann, sucht Halt in klaren Regeln, einfachen Wahrheiten, festen Feindbildern. Das ist im ersten Schritt allerdings kein politisches, sondern ein psychologisches Phänomen: Wer zu lange niemand sein durfte, wird irgendwann jemand. Koste es, was es wolle.
Jedoch ist häufig die eigene Menschlichkeit der Preis, den wir dafür zahlen.
Stellen Sie sich vor, in Ihnen sitzen verschiedene Stimmen am Tisch: der Angepasste, die Rebellin, der Vernünftige, die Verletzliche. Lassen Sie sie nacheinander sprechen. Wer wird überhört? Wer redet zu laut?
Authentizität ist kein Schalter, den man umlegen kann. Sie muss erarbeitet und geübt werden. Meist beginnen wir, sie im Kleinen zu üben, bevor wir uns auf’s größere Parkett wagen. Vielleicht sagen Sie das erste Mal authentisch „Nein“. Oder Sie öffnen sich in einem Gespräch.
Diese kleinen Handlungen summieren sich.
Grenzen setzen wir in der Regel nicht aus egoistischen Motiven. Wir setzen sie, weil wir von Anpassung die Nase voll haben. Denn Grenzen schützen nicht nur vor z.B. Respektlosigkeiten von außen, sondern auch vor Selbstverlust.
„Was ist denn eigentlich Wahrheit? Und müsste es nicht nur eine, überprüfbare Wahrheit geben? Was ist denn dann die „eigene Wahrheit“? Pippi Langstrumpf? Ich mach mir die Welt widdewidde wie sie mir gefällt?“
Ich habe mich mal kurz in einen vielleicht eher skeptischen Menschen versetzt, der lediglich „Mut zur eigenen Wahrheit“ liest. Und ja: diese Fragen sind berechtigt und ich möchte zumindest kurz meine Sicht auf diese Fragen schildern:
Was ist denn eigentlich Wahrheit? Und müsste es nicht nur eine, überprüfbare Wahrheit geben?
In meinen Augen ist Wahrheit etwas, das mit überprüfbaren und messbaren Tatsachen zu tun hat. Zwei plus Zwei ist immer Vier und damit wahr. Und in der Tat: das gilt für jeden Menschen auf der Welt.
Was ist denn dann die eigene Wahrheit?
Die eigene Wahrheit hat als Referenz nicht Tatsachen, sondern Gefühle. Und da wird es tatsächlich manchmal hakelig. Denn Gefühle sind subjektiv. Zwei Menschen können das selbe Essen essen, für den einen ist es sehr scharf, für den anderen lediglich gut gewürzt. Wer hat denn da recht?
In meinen Augen beide, weil beide ihre subjektive, auf ihren Empfindungen basierende Wahrheit haben. Und das hat nichts mit Pippi Langstrumpf zu tun, denn es geht nicht darum, sich die Welt zu machen, wie sie einem gefällt, sondern es geht darum, anzuerkennen, dass die eigenen Empfindungen richtig sind.
Die eigene Wahrheit ist nicht die Wahrheit
Wichtig ist hier zweierlei:
Die eigene (emotionale) Wahrheit ist wahr – aber nur für den Menschen, der sie gerade fühlt. Er hat weder Anspruch darauf, dass andere sie genauso sehen, noch muss er sie rechtfertigen oder beweisen.
Das heißt: Ich darf fühlen, was ich fühle, auch wenn es objektiv vielleicht „nicht stimmt“. (Lesen Sie hier mehr zu den fünf Freiheiten nach Virginia Satir.)
Ich darf Angst haben, auch wenn keine Gefahr besteht, ich darf traurig sein, auch wenn alle sagen, es gäbe keinen Grund dafür.
Mut zur eigenen Wahrheit bedeutet genau das: Die eigene innere Realität ernst zu nehmen, ohne sie zur allgemeinen Wahrheit zu erklären.Es ist der Mut, sich selbst zuzuhören, bevor man wieder auf das Außen reagiert.
Und es ist die Erkenntnis, das eigene Empfinden als Signal zu verstehen, so wie ein Navi. Denn erst dann, wenn wir unsere eigene Wahrheit kennen, können wir überhaupt unterscheiden, was unsere wirkliche Wahrheit ist und was wir als vermeintlich objektive Wahrheit von unseren Eltern oder anderen Autoritätspersonen gelernt haben. Hier fällt mir gerade der in meinen Sitzungen relativ häufig genannte Satz „Ich weiß gar nicht mehr richtig, wer ich eigentlich bin“ ein.
Das ist ein gefährlicher Zustand, denn wer nicht weiß, wer er ist, kann auch keinen Halt in sich selbst finden. Da wir aber alle einen gewissen Halt benötigen, besteht die Gefahr, dass er sich einer Gruppe zuwendet, die Halt verspricht, wie beispielsweise Sekten.
Teil 2 lesen Sie hier ab dem 27.10.2025.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Nein – im Gegenteil. Anpassung ist eine wichtige soziale Fähigkeit.
Ohne sie könnten wir gar nicht miteinander leben. Sie hilft uns, Rücksicht zu nehmen, Kompromisse zu schließen, Situationen richtig einzuschätzen.
Unproblematisch ist Anpassung also dann, wenn sie bewusst und freiwillig geschieht.
Kritisch wird sie, wenn sie zur Gewohnheit wird – wenn Sie automatisch spüren, was andere erwarten, und sich danach richten, ohne zu prüfen, ob es für Sie stimmig ist.
Dann entsteht mit der Zeit das Gefühl, nicht mehr „echt“ zu sein.
Gesunde Anpassung bedeutet: Ich kann mich einfügen, ohne mich selbst aufzugeben.
Es gibt kein eindeutiges Symptom, aber typische Anzeichen. Wenn Sie oft nicht wissen, was Sie wirklich wollen oder fühlen, wenn Sie Entscheidungen davon abhängig machen, was andere denken könnten oder wenn Sie innerlich müde werden, obwohl objektiv alles „gut“ aussieht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass Sie zu viel Energie in Anpassung stecken.
Viele Menschen beschreiben es als ein Gefühl der inneren Leere oder Entfremdung:
„Ich funktioniere, aber ich bin nicht mehr richtig da.“
Selbstverlust passiert nicht plötzlich, sondern schleichend und er lässt sich umkehren, sobald Sie beginnen, sich wieder zuzuhören.
Diese Angst ist sehr verständlich. Wir Menschen sind Beziehungswesen; Zugehörigkeit gibt Sicherheit.
Aber Zugehörigkeit, die Sie nur behalten können, wenn Sie sich verstellen, ist keine echte Verbindung, sondern eine Abhängigkeit.
Ja, wenn Sie anfangen, sich ehrlicher zu zeigen, kann sich Ihr Umfeld verändern. Manche Menschen werden irritiert reagieren, andere erleichtert.
Langfristig werden Sie diejenigen anziehen, die mit Ihrem echten Selbst in Resonanz gehen und nicht mit Ihrer Rolle.
Ehrlichkeit filtert Beziehungen: Sie bleibt dort, wo Begegnung wirklich möglich ist.
Ja, unbedingt.
Identität ist nichts Starres, das man einmal verliert und nie wiederfindet, sie ist ein lebendiger Prozess. Selbst wenn Sie sich über Jahre angepasst haben, bleibt ein Kern in Ihnen unverletzt. Das ist der Teil, der spürt, dass etwas nicht stimmt.
Wieder bei sich anzukommen bedeutet nicht, alles auf den Kopf zu stellen, sondern langsam wieder von innen nach außen zu leben: Fragen zu stellen, zu spüren, was Sie wollen, und kleine Schritte in diese Richtung zu gehen.
Ehrlichkeit ist der Anfang, Geduld der zweite Schritt und am Ende steht ein echteres Ich.